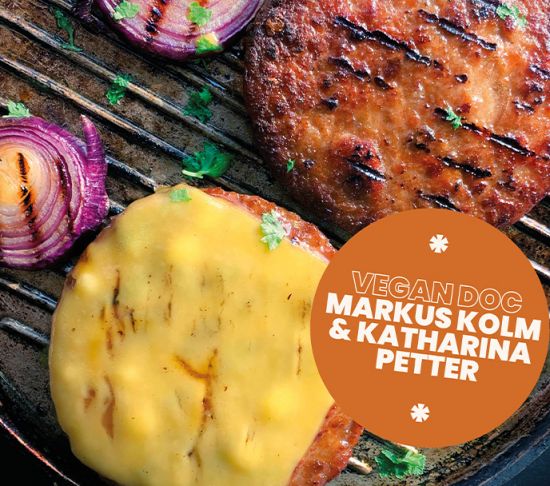Warum manche Menschen ihre vegane Ernährung aufgeben – eine medizinisch-psychologische Einordnung
Warum manche Menschen ihre vegane Ernährung aufgeben – eine medizinisch-psychologische Einordnung
von Dr. med. univ. Markus Kolm, Arzt für Allgemeinmedizin und Notarzt
In den letzten Jahren häufen sich in den sozialen Medien Berichte von ehemals vegan lebenden Personen, die wieder auf eine vegetarische oder sogar strikt fleischbasierte Ernährung umgestiegen sind. Häufig wird über gesundheitliche Beschwerden wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder Verdauungsprobleme berichtet. Verstärkt werden diese Erzählungen durch Influencer:innen, die sie teilen oder kommentieren. In der Folge entsteht der Eindruck, eine vegane Ernährung wäre grundsätzlich gesundheitsschädlich. Doch wie lassen sich diese Beobachtungen medizinisch und psychologisch einordnen?

Medizinische Perspektive: Erfahrungsberichte sind keine Beweise
Einzelne Erfahrungsberichte können wertvolle Hinweise geben – sie sind jedoch kein wissenschaftlicher Nachweis für einen ursächlichen Zusammenhang. Ein anschauliches Beispiel liefert der Blick auf Impfungen:
- Die genaue Anzahl der Berichte über Impfschäden im Internet ist nicht quantifizierbar, da das Internet eine Vielzahl von Plattformen (soziale Medien, Foren, Blogs) umfasst und keine zentrale Erfassung existiert. Viele dieser Berichte stammen aus Spontanmeldesystemen wie dem US-amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das öffentlich zugänglich ist und von jeder Person genutzt werden kann – unabhängig davon, ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang besteht. [1]
- Die Anzahl der tatsächlich auf eine Impfung zurückgeführten Impfschäden ist im Vergleich zur Gesamtzahl der Berichte sehr gering. [7] Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und U. S. Food and Drug Administration (FDA) betonen, dass die überwiegende Mehrheit der gemeldeten Nebenwirkungen lediglich zeitlich, nicht aber ursächlich mit der Impfung assoziiert ist. [4] Nur ein kleiner Teil wird nach eingehender Prüfung als kausal angesehen, z. B. seltene Fälle von Anaphylaxie oder Guillain-Barré-Syndrom. [2–3]
- Die American Academy of Pediatrics weist darauf hin, dass etwa 85–90 % der VAERS-Meldungen als nicht schwerwiegend gelten. Kausale Zusammenhänge werden erst durch epidemiologische Studien und aktive Überwachungssysteme wie das Vaccine Safety Datalink geprüft. [1] Selbst schwerwiegende Nebenwirkungen wie Anaphylaxie treten extrem selten auf (1–2 Fälle pro Million Dosen). [5–6]
Zusammengefasst: Es gibt viele Berichte über Impfschäden, doch nur ein kleiner Teil ist nach wissenschaftlicher Prüfung wirklich kausal. Ähnlich ist es bei Berichten über gesundheitliche Probleme durch vegane Ernährung: Zeitliches Auftreten bedeutet nicht zwangsläufig Ursache.
Psychologische Perspektive: Warum Menschen plötzlich von „vegan“ zu „carnivor“ wechseln
1. Erwartungshaltung (Nocebo-Effekt)
Unsere Überzeugungen und Erwartungen haben einen messbaren Einfluss auf unser Befinden. Wer wiederholt hört, vegane Ernährung könne krank machen, erwartet – oft unbewusst – Probleme. Diese Erwartung kann reale Beschwerden wie Müdigkeit, Bauchschmerzen oder Konzentrationsprobleme hervorrufen oder verstärken, selbst ohne objektiv messbare Ursache. Studien belegen: Negative Informationen über harmlose Substanzen können Symptome auslösen, weil das Gehirn auf eine vermeintliche „Gefahr“ vorbereitet ist.
Wechselt man daraufhin zu Mischkost, verschwindet diese Erwartung – und die Symptome bessern sich scheinbar wie durch die Ernährungsumstellung, was den Eindruck eines kausalen Zusammenhangs verstärkt.
2. Identifikation mit Influencer:innen und sozialer Vergleich
Influencer:innen haben in sozialen Netzwerken eine Vorbildfunktion. Menschen, die sich stark mit einer Person identifizieren, übernehmen deren Ansichten oft unkritisch. Berichtet ein:e Influencer:in glaubwürdig von negativen Erfahrungen mit veganer Ernährung, wirkt das wie eine „soziale Bestätigung“ und löst Zweifel an der eigenen Entscheidung aus.
Dabei ist nicht nur der Inhalt entscheidend, sondern auch die emotionale Bindung: Wer sich in einer Community beheimatet fühlt, ist besonders empfänglich für deren Botschaften. Ein Wechsel der Ernährungsweise eines Influencers kann so als Signal verstanden werden, dass die eigene Haltung falsch oder gefährlich ist – und löst eine abrupte Umorientierung aus.
3. Sozialer Druck und psychosomatische Beschwerden
Vegan lebende Menschen stehen im Alltag häufig unter zusätzlichem sozialem Druck:
• Wiederholte Rechtfertigungen gegenüber Familie, Freundeskreis oder Kolleg:innen („Warum isst du das nicht?“)
• Eingeschränkte Flexibilität bei Feiern, Reisen oder Geschäftsessen
• Ständiges Gefühl, „anders“ zu sein oder nicht der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen
Die Aussage, dass vegan lebende Menschen im Alltag häufig unter zusätzlichem sozialem Druck stehen, ist durch die aktuelle Literatur gut belegt. Studien zeigen, dass Veganer:innen regelmäßig mit Rechtfertigungsdruck, eingeschränkter Flexibilität und einem Gefühl des Andersseins konfrontiert sind, was zu psychosozialem Stress führen kann. [8–12, 16]
Typische Folgen eines solchen chronischen Stresses sind:
• Müdigkeit und Erschöpfung („Brain Fog“)
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Schlafstörungen
• Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder andere psychosomatische Beschwerden
Diese Mechanismen sind physiologisch plausibel: Chronischer sozialer Stress kann wichtige Stressregulationssysteme (z. B. Sympathikus, HPA-Achse) dysregulieren und so zu Erschöpfung, Schlafproblemen und kognitiven Einschränkungen führen. [8–10, 13, 16]
Nach der Rückkehr zu Mischkost berichten Betroffene oft von rascher Besserung. Naheliegend erscheint, dass die Symptome durch Nährstoffmängel bedingt waren. Tatsächlich legen qualitative Studien nahe, dass vor allem der Wegfall des sozialen Drucks eine zentrale Rolle spielt. Die Annahme, dass eine Besserung der Symptome nach der Aufgabe der veganen Ernährung primär auf den Wegfall des sozialen Drucks zurückzuführen ist – und nicht auf die Ernährung selbst –, ist durch qualitative Forschung gestützt, die den sozialen Kontext als entscheidenden Einflussfaktor identifiziert.
Die psychische Belastung durch sozialen Druck ist individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt: Während einige negative Folgen erleben, berichten andere über gesteigertes Wohlbefinden und Sinnhaftigkeit innerhalb veganer Communitys. [8–9, 14–16]
Zusammengefasst: Sozialer Druck kann zu messbaren psychischen und körperlichen Stressreaktionen führen, die sich nach dem Wegfall des Drucks bessern. Diese Effekte treten nicht zwangsläufig bei allen vegan lebenden Menschen auf.
4. Kognitive Dissonanz und radikale Richtungswechsel
Wer lange überzeugt vegan lebt, investiert viel Identität und Moral in diese Entscheidung. Kommen dann Zweifel auf (z. B. durch Berichte über vegane „Schäden“), entsteht kognitive Dissonanz: ein unangenehmer innerer Konflikt zwischen dem bisherigen Selbstbild und neuen Informationen.
Um diese Spannung schnell aufzulösen, wird nicht moderat angepasst, sondern oft radikal gewechselt – z. B. zu einer carnivoren Ernährung. Psychologisch schafft das eine neue, klare Identität, statt in Unsicherheit zu verharren.
Fazit: Hinterfragen statt nachahmen
Medizinisch ist klar: Eine gut geplante vegane Ernährung ist langfristig sicher, wenn sie ausreichend Kalorien enthält, abwechslungsreich gestaltet ist und kritische Nährstoffe wie Vitamin B12 supplementiert werden.
Psychologisch gilt: Beschwerden entstehen nicht immer durch das, was wir essen – sondern oft durch das, was wir darüber glauben, wie sehr wir uns damit identifizieren und wie unser Umfeld reagiert.
Wer gesundheitliche Probleme bemerkt, sollte:
- ärztlich mögliche Nährstoffmängel prüfen lassen,
- ernährungsfachliche Beratung einholen und
- die eigene Erwartungshaltung und den Einfluss der sozialen Medien reflektieren.
Evidenz zählt mehr als Einzelfälle. Das schützt vor vorschnellen, radikalen Entscheidungen – und bewahrt die Freiheit, die eigene Ernährung gesund und individuell zu gestalten.
Quellenverweise
[1] Strategies for Improving Vaccine Communication and Uptake. O’Leary S. T., Opel D. J., Cataldi J. R., Hackell J. M. Pediatrics. 2024;:e2023065483. doi: 10.1542/peds.2023-065483.
[2] The State of Vaccine Safety Science: Systematic Reviews of the Evidence. Dudley M. Z., Halsey N. A., Omer S. B. et al. The Lancet. Infectious Diseases. 2020;20(5):e80-e89. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30130-4.
[3] Deaths Following Vaccination: What Does the Evidence Show? Miller E. R., Moro P. L., Cano M., Shimabukuro T. T. Vaccine. 2015;33(29):3288-92. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.05.023.
[4] Understanding Vaccine Safety and the Roles of the FDA and the CDC. Meissner H. C. The New England Journal of Medicine. 2022;386(17):1638-1645. doi: 10.1056/NEJMra2200583.
[5] Anaphylaxis After Vaccination Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, 1990–2016. Su J. R., Moro P. L., Ng C. S. et al. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2019;143(4):1465-1473. doi: 10.1016/j.jaci.2018.12.1003.
[6] Vaccine Safety. Jacobson R. M. Immunology and Allergy Clinics of North America. 2003;23(4):589-603. doi: 10.1016/s0889-8561(03)00090-0.
[7] Vaccine Adverse Events: Separating Myth From Reality. Spencer J. P., Trondsen Pawlowski R. H., Thomas S. American Family Physician. 2017;95(12):786-794.
[8] Friends Not Food: A Scoping Review Into Veg*an Mental Health and Psychosocial Wellbeing. Cornish S., Jones L., Sheeran N. Appetite. 2025;:108207. doi: 10.1016/j.appet.2025.108207.
[9] Experiences of Initiating and Maintaining a Vegan Diet Among Young Adults: A Qualitative Study. Williams E., Vardavoulia A., Lally P., Gardner B. Appetite. 2023;180:106357. doi: 10.1016/j.appet.2022.106357.
[10] The Psychosocial Aspects of Vegetarian Diets: A Cross-Sectional Study of the Motivations, Risks, and Limitations in Daily Life. Białek-Dratwa A., Stoń W., Staśkiewicz-Bartecka W. et al. Nutrients. 2024;16(15):2504. doi: 10.3390/nu16152504.
[11] „If I Became a Vegan, My Family and Friends Would Hate Me:“ Anticipating Vegan Stigma as a Barrier to Plant-Based Diets. Markowski K. L., Roxburgh S. Appetite. 2019;135:1-9. doi: 10.1016/j.appet.2018.12.040.
[12] Eating Vegan Due to Cancer: A Different Social Experience Than Other Vegan Dieters? MacInnis C. C., Ferry C. V. Appetite. 2024;194:107161. doi: 10.1016/j.appet.2023.107161.
[13] Vegetarianism and Veganism Compared With Mental Health and Cognitive Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iguacel I., Huybrechts I., Moreno L. A., Michels N. Nutrition Reviews. 2021;79(4):361-381. doi: 10.1093/nutrit/nuaa030.
[14] Young Adults’ Transition to a Plant-Based Diet as a Psychosomatic Process: A Psychoanalytically Informed Perspective. von Essen E. Appetite. 2021;157:105003. doi: 10.1016/j.appet.2020.105003.
[15] „More Than a Diet“: A Qualitative Investigation of Young Vegan Women’s Relationship to Food. Costa I., Gill P. R., Morda R., Ali L. Appetite. 2019;143:104418. doi: 10.1016/j.appet.2019.104418.
[16] Going Veggie: Identifying and Overcoming the Social and Psychological Barriers to Veganism. Bryant CJ, Prosser AMB, Barnett J. Appetite. 2022;169:105812. doi:10.1016/j.appet.2021.105812.
Bildquelle: Image Hunter/Pexels